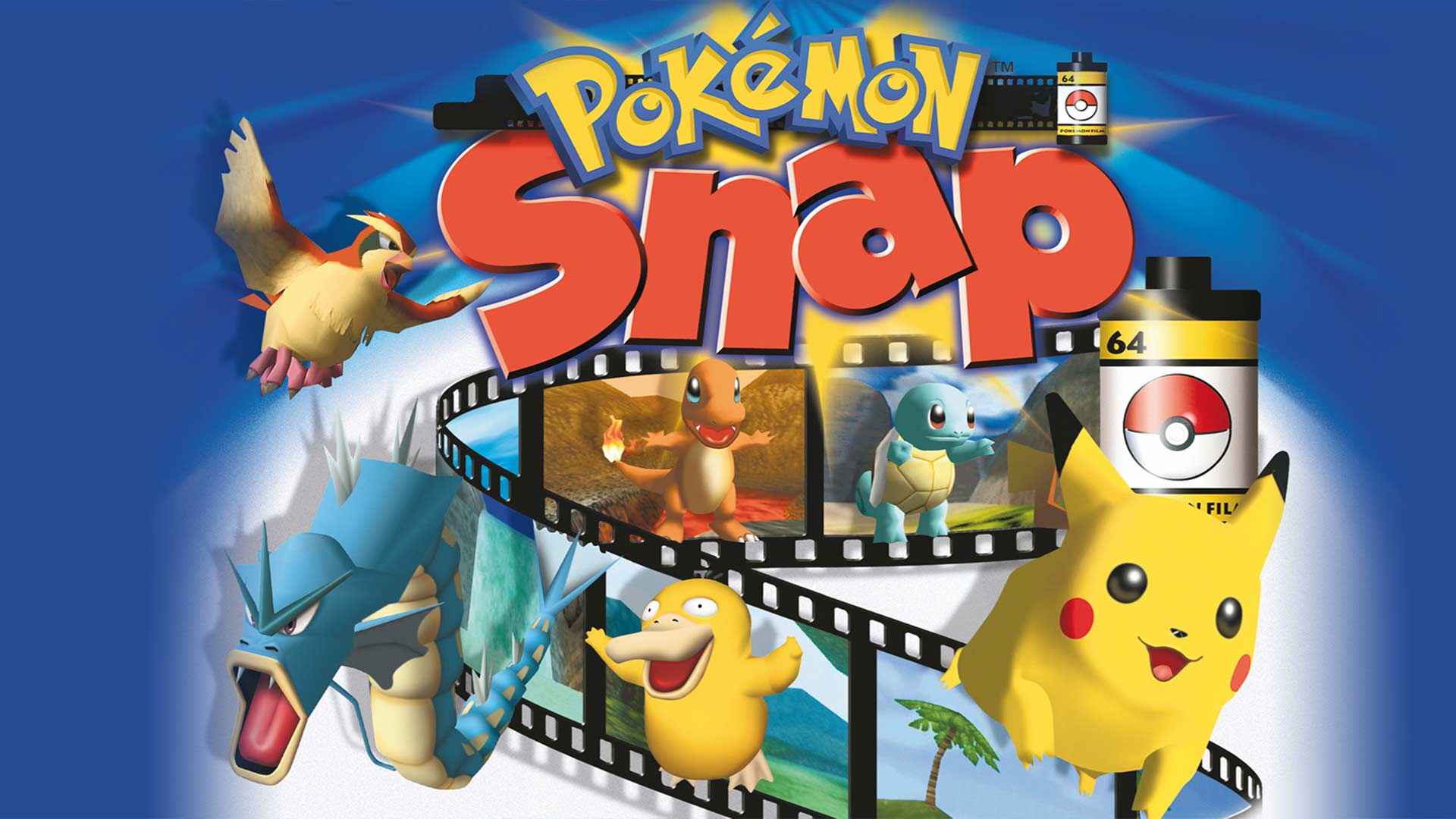Pünktlich zu Halloween feiern wir einen Horror-Klassiker der PS2-Ära. Resident Evil 4 ließ uns damals wie heute mit düsterem Setting und Parasiten-Freaks das Blut in den Adern gefrieren. Wir nehmen das just erscheinende Remake zum Anlass für unseren Klassiker-Check.
In Resident Evil 4 bin ich persönlich relativ unbefleckt hineingegangen. Natürlich sagte mir das Franchise ein bisschen was und den einen oder anderen Teil hatte ich auch mal gespielt, doch ein Die-Hard-Fan war ich nicht unbedingt. Allerdings hatte ein Trailer mein Interesse geweckt, dessen Tenor war, dass Capcom hier mit der ein oder anderen Konvention gebrochen habe. Durch die „Über-die-Schulter“-Perspektive bekam der Spieler nun eher das Gefühl, mittendrin zu sein in der Freak-Action und weniger einen Film anzusehen. Noch entscheidender fand ich aber, dass man sich diesmal nicht durch ein Zombie-verseuchtes Racoon City schleppt, wo die Umbrella Corporation mal wieder Schindluder getrieben hat.
Stattdessen hat es Leon Kennedy in irgendeine europäische Provinz verschlagen, wo er die gekidnappte Tochter des US-Präsidenten befreien soll. Jedoch stimmt irgendetwas mit den Ortsansässigen ganz und gar nicht, soviel wurde anhand der berühmten Dorf-Panik-Szene klar, die in dem erwähnten Trailer zu sehen war. Irgendwas machte die Bewohner zu blutrünstigen Berserkern, die mit allen Hieb- und Stichwerkzeugen, die sie in die Finger bekamen, Jagd auf Leon machten. Der musste alles aus sich und den begrenzten Munitionsvorräten herausholen, um zu überleben. Eine Flucht durch den Kuhstall, ein Sprung aus dem Fenster, irgendwo in Deckung gehen, wo man möglichst noch einen der Verrückten umnieten kann – mein Interesse war geweckt.
Ungewaschene Hinterwäldler schwingen die Kettensäge
Seien wir ehrlich: Ein Game wie Resident Evil – welchen Teil auch immer – zockt man nicht wegen origineller Storylines oder interessanter Charaktere. Hier geht es um Grusel, Ekel, Schrecken – wir wollen unser Herz klopfen und die Gänsehaut im Nacken spüren. Und wenn das mit Klischees erreicht – go for it! Das altbewährte Hintlerwäldler-Setting funktioniert bei mir persönlich da immer ganz gut. Ungewaschene Freaks, die in ländlichen Arealen nach ihren eigenen, uns fremden, Prinzipien leben, holen mich irgendwie ab. Filme wie „The Hills have Eyes“, „Wrong Turn“ oder „The Devil’s Rejects” strahlen eine seltsame Faszination aus.
Deswegen hat mich auch das Setting von RE4 so angesprochen. Ich hätte angesichts der ersten Bilder auf Osteuropa getippt – Karpaten oder so. Stattdessen spielt das Game an einem nicht näher benannten Ort in Spanien. Wahrscheinlich wollte man die Sprachbarriere für den Großteil des Kundenstamms nicht zu groß werden lassen. Dieser befindet sich nun mal in der westlichen Hemisphäre und ist somit dem Spanischen näher als dem Rumänischen. Sprechende Namen wie das Dorf „Pueblo“ oder der große Bossgegner „El Gigante“ können sich noch eher hergeleitet werden.

Für den US-Mann Leon ist es so oder so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Oder sagen wir lieber: Ein sehr dunkler. Die Atmosphäre stimmt nämlich von Anfang an und wenn man die erste Hütte betritt, auf der Suche nach Ashley und den wild gewordenen Besitzer mit vier schlecht platzierten Schüssen aus der Dienstwaffe niederstreckt, dann fühlt man sich langsam rein in die beklemmende Atmosphäre. Ein lauer Aufgalopp und bis hierhin dachte ich tatsächlich noch, ich würde vielleicht ohne vieläugiges, tentakelschwingendes, insektenhaftes Geekel durch das Spiel kommen. Denn auch die folgende und eingangs erwähnte Dorfszene schickt uns zwar die Leatherface-Reminszenz doch trotz dessen scheinbar übermenschlicher Kräfte kann man hier annehmen, es hauptsächlich mit humanoiden Gegnern zu tun zu haben, die vielleicht diesem ominösen Las Plagas Kult anhängen, von dem immer mal zu lesen ist.
Mit der Shotgun in die okkulte Messe
Ein wahrer Kunstgriff der Entwickler, wie man abrupt vom Gegenteil überzeugt wird. An einer nicht einmal nennenswerten Stelle im Spiel knallen wir mal wieder einen Eingeborenen ab, dem daraufhin plötzlich ein riesiger Fangarm aus dem Kopf wächst, der nach uns schnappt. Schnell jagen wir eine Ladung blei auf dieses absurde Gebilde und wissen: „Alles klar, ab hier kann alles passieren“.
Und das tut es auch. Die große Stärke dieses Spiels liegt darin, den Spieler immer wieder in solche Situationen zu versetzen, die einen wirklich stressen, beklemmen, abstoßen. Wenn man sich etwa mit dem Ashley und dem abtrünnigen Las Plagas Forscher Luis Serra auf einem Dachboden verschanzt und die Freaks durch sämtliche Fenster und Luken reinkommen, dann ist das einfach Survival-Feeling at its best.
Oder habt ihr schonmal von einer Empore aus durch ein Zielfernrohr einer Gruppe gruseliger Mönche bei irgendeinem okkulten Ritual zugeschaut? Das Herz bis zum Halse klopfend weil ihr wisst – ihr müsst daran vorbei. Wenn ihr den Abzug betätigt, könnt ihr einen aus der Ferne erledigen, vielleicht auch zwei. Aber dann werden die verbleibenden euch all ihren Zorn entgegenbringen – was das auch immer heißen mag.
Tentakel in der Robe
Der finstere Guru Osmund Saddler steht hinter dem Illuminados-Orden und hat zunächst nur einige Comic-Bösewicht-haften Palaver-Auftritte. Als allerdings in einer Videosequenz plötzlich eine Tentakel unter seiner Kutte herausfährt und Schaden anrichtet, wird einmal mehr klar, dass die natürliche Ordnung an diesem Ort außer Kraft gesetzt ist. Hier steht offenbar jeder im körperlichen Austausch mit den parasitären Las Plagas und so sind fiese Mutationen an der Tagesordnung. Die Resident Evil Designer können sich somit in puncto absurde Monsterdesigns voll austoben.

Der für sich schon groteske, weil irgendwie kindliche und irgendwie uralte kleinwüchsige Aristokrat Salazar wird stets von zwei sinistren Leibwächtern umgeben, die nur aus langen Roben zu bestehen scheinen, unter deren Kapuzen leuchten Augen hervorblitzen. Als Salazar jedoch einen davon auf Leon hetzt, müssen wir auf die harte Tour lernen, dass die beiden nicht bloß Deko sind. Es entsteht ein Hauch von Predator-Verfolgung. Zwar habe ich gemerkt, dass man den überlegenen Jäger mit flüssigem Stickstoff kurzfristig einfrieren kann, doch ist es mir nicht gelungen, das Ganze dann mit einem Schuss in tausend Scherben zu sprengen. Stattdessen schleppte ich mich schwer verwundet in einen Aufzug und entkam so meinem Verfolger.
In einem narrativen Kunstgriff sehen wir dann, wie der aufgebrachte Salazar befiehlt, dass „Es“ sich nun um Leon kümmern soll. Und was genau „Es“ ist… kein Clown, so viel kann ich versprechen. Allgemein besteht die große Stärke von RE4 darin, Situationen zu kreieren, die Unbehagen, um nicht zu sagen „Grusel“, auslösen. Das sind oftmals altbewährte Motive, die aber einfach funktionieren. Natürlich ist nicht jede Szene auf Top-Niveau. Beispielsweise die Abrechnung mit Leons altem Gefährten Krauser wirkt irgendwie unpassend und hineingeschrieben. Die Auseinandersetzung basiert dann vor allem auf einer Quicktime-Klopperei, die man eher so hinnimmt.
Ähnliches bei dem Bosskampf mit „Del Largo“, dem Ungeheuer aus dem See. Eigentlich prädestiniert für eine furchteinflößende Szene, da hier die Furcht des Menschen vor unbekannten Tiefen angesprochen wird. Doch bleibt der Fight im wahrsten Sinne des Wortes recht oberflächlich und verglichen mit den späteren Bosskämpfen des Spiels wäre hier mehr drin gewesen.
Dies sind aber nur Erbsenzählereien. Unterm Strich bleibt ein beeindruckendes Freak-Arsenal, jede Menge Adrenalin und ein gehöriger Umfang. Mehr kann man von einem Horror-Game eigentlich nicht erwarten.
The good
- Gänsehaut-Atmosphäre
- Kreatives Monster-Design
- Großartige Action-Szenen
The bad
- Bei zwei bis drei Bossfights wäre mehr drin gewesen
- NPC Ashley ist für viele Fans der Jar Jar Binks des RE-Universums